Wir laden die interessierte Dresdner Öffentlichkeit herzlich ein zum öffentlichen Abendvortrag anlässlich der Konferenz. Vortragssprache ist deutsch. Der Eintritt ist frei.
Termin: Dienstag, 17. September 2024, 18:30-19:30 Uhr.
Ort: Technische Universität Dresden, Barkhausen-Bau, Schönfeld-Hörsaal (BAR/SCHÖ/E)
Anschrift: Georg-Schumann-Straße 13, 01069 Dresden
Georg-Schumann-Straße Ecke Nöthnitzer Straße
Straßenbahn Linie 3, Haltestelle Münchner Platz
Die Entstehung der chemischen Elemente im Universum
Prof. emer. F.-K. Thielemann, Universität Basel
Kurzfassung:
Wie sind die chemischen Elemente entstanden, die wir heute auf der Erde, im Sonnensystem, und im Kosmos finden können, z.B. Wasserstoff, Helium, Lithium, Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Silizium, Kalzium, Eisen, Nickel, bis hin zu schweren Elementen wie Blei oder Uran und Thorium? Aus dem heutigen Stand der Astrophysik (verbunden mit kernphysikalischen Kenntnissen) wissen wir, dass im Wesentlichen Sterne die dafür verantwortlichen Quellen darstellen.
Sterne entstehen, wenn eine Gaswolke unter ihrer Eigengravitation kollabiert. Wenn Dichte und Temperatur im Inneren die Fusion der Atomkerne des stellaren Plasmas ermöglichen, heizt und stabilisiert frei werdende Energie den Stern. Im Lauf der Sternentwicklung können nacheinander Wasserstoff-, Helium-, Kohlenstoff-, Neon-, Sauerstoff- und Siliziumbrennen stattfinden, jeweils mit den Produkten der vorherigen Brennphase als neuem Brennstoff. Im letzten Schritt entstehen z.B. Eisen und Nickel, d.h. Atomkerne mit den größten Bindungsenergien pro Nukleon. Es bleibt zu klären, wie die schwereren Elemente entstanden sind, eine enorm wichtige Rolle spielt dabei der Einfang von freien Neutronen auf Atomkerne.
Die Ausgangsmasse eines Sterns bestimmt, welche Brennphasen durchlaufen werden. Sterne mit weniger als acht Sonnenmassen (Mʘ) haben nach dem Helium-Brennen so viel Masse durch Sternwinde verloren, dass sie unter die sog. Chandrasekhar-Grenze fallen (sie beschreibt die Maximalmasse, die der Druck des Elektronengases stabilisiert). Danach entsteht ein stabiler, sich auf langen Zeitskalen abkühlender Weißer Zwerg. Massereichere Objekte zünden alle Brennphasen bis anschließend die zentrale Kontraktion zu einer „Kernkollaps-Supernova“ führt. Dabei entsteht ein Neutronenstern mit maximal etwa 2 Mʘ oder bei größeren Massen ein Schwarzes Loch. Die darüber liegenden Hüllen werden explosiv abgeworfen.
In Doppelsternsystemen ist Massenaustausch möglich. Dabei können abgekühlte Weiße Zwerge als Typ Ia-Supernovae explodieren oder es kann z.B. zu Verschmelzungen von Neutronensternen kommen. Es soll in diesem Vortrag gezeigt werden, wie man aus kernphysikalischen Messungen, Computersimulationen der Sternentwicklung, sowie astronomischen Beobachtungen von Sternspektren, wie auch der Analyse von Häufigkeiten in Meteoriten, die Entstehung und die heute bekannte Verteilung der chemischen Elemente im Universum verstehen kann. Lediglich Wasserstoff, Helium und Lithium können nicht durch die Rolle von Sternen erklärt werden, sie gehen auf die Frühzeit des Universums zurück, den Urknall.
Zum Vortragenden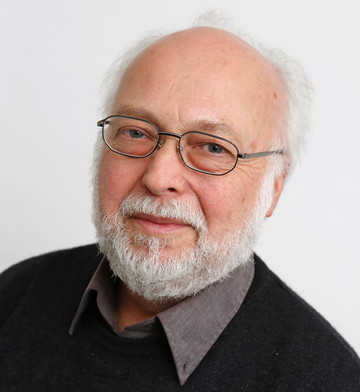
Friedrich-Karl Thielemann studierte an der TU Darmstadt Physik und Mathematik. Dissertation am Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching. Nach Postdocanstellungen in den USA und Deutschland Assistant und Associate Professor am Astronomy Department der Harvard University, danach Ordinariat an der Universität Basel. Seit seiner Emeritierung auch Mitarbeiter in der Theorieabteilung des GSI Helmholtzzentrums für Schwerionenforschung. Er wurde mit der Otto-Hahn-Medaille der Max-Planck-Gesellschaft, dem Hans-A.-Bethe-Preis der American Physical Society, dem Lise-Meitner-Preis der European Physical Society und der Karl-Schwarzschild- Medaille der Astronomischen Gesellschaft geehrt. Gewählter Fellow der APS und Ehrenmitglied der Schweizer Physikalischen Gesellschaft.

